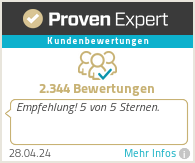Bei der Zuschreibung „Martin Engelbrecht (attributed to)“ handelt es sich nicht um einen eindeutig belegten Originalkünstler, sondern um eine Zuweisung, die auf stilistischen, technischen oder historischen Indizien basiert. Solche Zuschreibungen entstehen häufig, wenn Werke aus einer bestimmten Epoche oder Werkstatt stammen, aber keine eindeutigen Signaturen oder Dokumente existieren, die die Urheberschaft zweifelsfrei belegen. In diesem Fall wird angenommen, dass das Werk von Martin Engelbrecht stammen könnte, doch es fehlen die notwendigen Beweise für eine endgültige Zuordnung. In der Kunstgeschichte sind solche Zuschreibungen ein wichtiges Instrument, um Werke zumindest annähernd in einen künstlerischen Kontext einzuordnen und sie mit bekannten Persönlichkeiten oder Werkstätten zu verbinden. Dennoch bleibt stets ein Unsicherheitsfaktor bestehen, der eine genaue Einordnung erschwert und Raum für weitere Forschung lässt.
Die Praxis der Zuschreibung ist besonders im Bereich der Druckgrafik und des Kunsthandwerks verbreitet, wo Werkstattarbeit und Kopien eine große Rolle spielten. Gerade bei Künstlern wie Martin Engelbrecht, die im 18. Jahrhundert als Kupferstecher und Verleger tätig waren, ist es oft schwierig, Originale von Werkstattarbeiten oder Nachahmungen zu unterscheiden. Die Bezeichnung „attributed to“ signalisiert daher sowohl eine Annäherung an den mutmaßlichen Urheber als auch eine methodische Vorsicht. Für Sammler, Museen und Kunsthistoriker ist diese Kennzeichnung ein Hinweis darauf, dass weitere Untersuchungen notwendig sind, um die Provenienz und Authentizität des Werkes zu klären. Solche Werke werden häufig weiterhin erforscht, um durch stilistische Vergleiche, Materialanalysen oder archivalische Funde eine genauere Zuschreibung zu ermöglichen.
×




_-_De_dwerg_Crispin_Skarnitz_ca_1710Der_Ehrnveste_u_Hochweisse_Herr_Crispin_Skarnit_-_(MeisterDrucke-1328032).jpg)
_-_De_dwerg_Crispin_Skarnitz_ca_1710Der_Ehrnveste_u_Hochweisse_Herr_Crispin_Skarnit_-_(MeisterDrucke-1328032).jpg)
_-_De_Spaanse_dwerg_Don_Miguel_Zorrero_Tuerto_ca_1710Don_Miguel_Zorrero_Tuerto_Cava_-_(MeisterDrucke-1327320).jpg)
_-_De_Spaanse_dwerg_Don_Miguel_Zorrero_Tuerto_ca_1710Don_Miguel_Zorrero_Tuerto_Cava_-_(MeisterDrucke-1327320).jpg)
_-_De_joodse_dwerg_Natan_Hirschl_ca_1710Natan_Hirschl_der_Pragerische_Judenschaft_P_-_(MeisterDrucke-1327844).jpg)
_-_De_joodse_dwerg_Natan_Hirschl_ca_1710Natan_Hirschl_der_Pragerische_Judenschaft_P_-_(MeisterDrucke-1327844).jpg)
_-_De_dwerg_Blasius_Rauchmantl_als_alchemist_ca_1710Herr_Blasius_Rauchmantl_der_fru_-_(MeisterDrucke-1328886).jpg)
_-_De_dwerg_Blasius_Rauchmantl_als_alchemist_ca_1710Herr_Blasius_Rauchmantl_der_fru_-_(MeisterDrucke-1328886).jpg)
_-_Dwerg_als_de_Franse_Mademoiselle_Jolicoeur_ca_1710Mademoiselle_Jolicoeur_dancean_-_(MeisterDrucke-1328356).jpg)
_-_Dwerg_als_de_Franse_Mademoiselle_Jolicoeur_ca_1710Mademoiselle_Jolicoeur_dancean_-_(MeisterDrucke-1328356).jpg)
_-_De_dwerg_Holloka_Tschimitschko_Buttiam_Uran_als_huzaar_ca_1710Holloka_Tschimitsc_-_(MeisterDrucke-1327232).jpg)
_-_De_dwerg_Holloka_Tschimitschko_Buttiam_Uran_als_huzaar_ca_1710Holloka_Tschimitsc_-_(MeisterDrucke-1327232).jpg)
_-_De_dwerg_Gertraud_Knuertzlin_ca_1710Gertraud_Knuertzlin_Baijerische_Diern_(title_-_(MeisterDrucke-1326902).jpg)
_-_De_dwerg_Gertraud_Knuertzlin_ca_1710Gertraud_Knuertzlin_Baijerische_Diern_(title_-_(MeisterDrucke-1326902).jpg)
_-_De_dwerg_Monsieur_le_Marquis_de_Sauterelle_ca_1710Monsieur_le_Marquis_de_Sautere_-_(MeisterDrucke-1328876).jpg)
_-_De_dwerg_Monsieur_le_Marquis_de_Sauterelle_ca_1710Monsieur_le_Marquis_de_Sautere_-_(MeisterDrucke-1328876).jpg)
_-_De_dwerg_Chevalier_Rondeau_als_een_parlementslid_ca_1710Monsieur_le_Chevalier_Ro_-_(MeisterDrucke-1326964).jpg)
_-_De_dwerg_Chevalier_Rondeau_als_een_parlementslid_ca_1710Monsieur_le_Chevalier_Ro_-_(MeisterDrucke-1326964).jpg)
_-_Titelprent_voor_de_serie_Il_Callotto_resurcitato_oder_Neu_eingerichtes_Zwerchen_-_(MeisterDrucke-1328298).jpg)
_-_Titelprent_voor_de_serie_Il_Callotto_resurcitato_oder_Neu_eingerichtes_Zwerchen_-_(MeisterDrucke-1328298).jpg)
_-_De_dwerg_Christl_Vestnbalkh_ca_1710Christl_Vestnbalkh_Buerg_Schuetz_beij_der_Tij_-_(MeisterDrucke-1327226).jpg)
_-_De_dwerg_Christl_Vestnbalkh_ca_1710Christl_Vestnbalkh_Buerg_Schuetz_beij_der_Tij_-_(MeisterDrucke-1327226).jpg)
_-_De_dwerg_Ursula_Schleglin_ca_1710Ursula_Schleglin_Maijr_Mensch_im_Herren_hoff_zu_-_(MeisterDrucke-1327848).jpg)
_-_De_dwerg_Ursula_Schleglin_ca_1710Ursula_Schleglin_Maijr_Mensch_im_Herren_hoff_zu_-_(MeisterDrucke-1327848).jpg)
_-_De_Spaanse_dwerg_Don_Guappos_ca_1710Don_Guappos_von_dem_Geblueth_des_Don_Quixote_-_(MeisterDrucke-1327247).jpg)
_-_De_Spaanse_dwerg_Don_Guappos_ca_1710Don_Guappos_von_dem_Geblueth_des_Don_Quixote_-_(MeisterDrucke-1327247).jpg)
_-_De_dwerg_Simon_Flenschl_ca_1710Simon_Flenschl_Oberknecht_dess_reichen_freij_baur_-_(MeisterDrucke-1328920).jpg)
_-_De_dwerg_Simon_Flenschl_ca_1710Simon_Flenschl_Oberknecht_dess_reichen_freij_baur_-_(MeisterDrucke-1328920).jpg)
_-_De_Franse_dwerg_Don_Luis_Champ-merdant_ca_1710Don_Luis_Champ-merdant_Brigadier_d_-_(MeisterDrucke-1328357).jpg)
_-_De_Franse_dwerg_Don_Luis_Champ-merdant_ca_1710Don_Luis_Champ-merdant_Brigadier_d_-_(MeisterDrucke-1328357).jpg)
_-_De_dwerg_Ruffanella_als_herderin_ca_1710Ruffanella_dess_Verliebten_Plorianders_b_-_(MeisterDrucke-1327564).jpg)
_-_De_dwerg_Ruffanella_als_herderin_ca_1710Ruffanella_dess_Verliebten_Plorianders_b_-_(MeisterDrucke-1327564).jpg)
_-_De_dwerg_Gilles_Platfues_als_Franse_dansmeester_ca_1710Monsr_Gilles_Platfues_Mai_-_(MeisterDrucke-1328825).jpg)
_-_De_dwerg_Gilles_Platfues_als_Franse_dansmeester_ca_1710Monsr_Gilles_Platfues_Mai_-_(MeisterDrucke-1328825).jpg)
_-_De_dwerg_Cornelius_Guttman_als_hoorndrager_ca_1710Herr_Cornelius_Guttman_Zechmei_-_(MeisterDrucke-1327734).jpg)
_-_De_dwerg_Cornelius_Guttman_als_hoorndrager_ca_1710Herr_Cornelius_Guttman_Zechmei_-_(MeisterDrucke-1327734).jpg)
_-_Karikatuur_van_Nutsch-MoloffNutsch-Moloff_Ein_fuehrnehmer_Lapplaendischer_Landhe_-_(MeisterDrucke-1328110).jpg)
_-_Karikatuur_van_Nutsch-MoloffNutsch-Moloff_Ein_fuehrnehmer_Lapplaendischer_Landhe_-_(MeisterDrucke-1328110).jpg)
_-_De_dwerg_Bartholdus_Gursalkawiz_als_pelgrim_uit_Compostella_ca_1710Bartholdus_Gu_-_(MeisterDrucke-1326897).jpg)
_-_De_dwerg_Bartholdus_Gursalkawiz_als_pelgrim_uit_Compostella_ca_1710Bartholdus_Gu_-_(MeisterDrucke-1326897).jpg)
_-_De_dwerg_Madame_Sophia_Luxuria_ca_1710Madame_Sophia_Luxuria_General_Staabs_leib_-_(MeisterDrucke-1327155).jpg)
_-_De_dwerg_Madame_Sophia_Luxuria_ca_1710Madame_Sophia_Luxuria_General_Staabs_leib_-_(MeisterDrucke-1327155).jpg)
_-_De_dwerg_Margl_Woltzenthoulerin_ca_1710Margl_Woltzenthoulerin_Mayr-Thirn_auff_de_-_(MeisterDrucke-1327690).jpg)
_-_De_dwerg_Margl_Woltzenthoulerin_ca_1710Margl_Woltzenthoulerin_Mayr-Thirn_auff_de_-_(MeisterDrucke-1327690).jpg)
_-_De_dwerg_Veith_Schueberl_von_Guempendriel_ca_1710Veith_Schueberl_von_Guempendrie_-_(MeisterDrucke-1326901).jpg)
_-_De_dwerg_Veith_Schueberl_von_Guempendriel_ca_1710Veith_Schueberl_von_Guempendrie_-_(MeisterDrucke-1326901).jpg)
_-_De_dwerg_Oswald_van_Stroblbardt_ca_1710Ihro_Excedenz_Herr_Oswald_von_Stroblbardt_-_(MeisterDrucke-1328591).jpg)
_-_De_dwerg_Oswald_van_Stroblbardt_ca_1710Ihro_Excedenz_Herr_Oswald_von_Stroblbardt_-_(MeisterDrucke-1328591).jpg)
_-_De_dwerg_Blassl_Broatgosch_ca_1710Blassl_Broatgosch_Juramentirter_Nachtwachter_u_-_(MeisterDrucke-1327724).jpg)
_-_De_dwerg_Blassl_Broatgosch_ca_1710Blassl_Broatgosch_Juramentirter_Nachtwachter_u_-_(MeisterDrucke-1327724).jpg)
_-_De_dwerg_Pantaleon_Buergman_van_de_Zwitserse_Garde_te_Rome_ca_1710Pantaleon_Buer_-_(MeisterDrucke-1328877).jpg)
_-_De_dwerg_Pantaleon_Buergman_van_de_Zwitserse_Garde_te_Rome_ca_1710Pantaleon_Buer_-_(MeisterDrucke-1328877).jpg)
_-_De_dwerg_Piperouk_als_directeur_van_een_tabakscompagnie_ca_1710Monsieur_Piperouk_-_(MeisterDrucke-1326949).jpg)
_-_De_dwerg_Piperouk_als_directeur_van_een_tabakscompagnie_ca_1710Monsieur_Piperouk_-_(MeisterDrucke-1326949).jpg)
_-_De_dwerg_Hali_Nasili_Pascha_ca_1710Hali_Nasili_Pascha_dess_Visir_Knupperli_Brude_-_(MeisterDrucke-1328489).jpg)
_-_De_dwerg_Hali_Nasili_Pascha_ca_1710Hali_Nasili_Pascha_dess_Visir_Knupperli_Brude_-_(MeisterDrucke-1328489).jpg)
_-_De_dwerg_Ploriander_als_herder_ca_1710Ploriander_der_in_die_Schaefferin_Ruffanel_-_(MeisterDrucke-1326909).jpg)
_-_De_dwerg_Ploriander_als_herder_ca_1710Ploriander_der_in_die_Schaefferin_Ruffanel_-_(MeisterDrucke-1326909).jpg)
_-_De_dwerg_Hans_Sausakh_von_Wurstelfeld_ca_1710Hans_Sausakh_von_Wurstelfeld_Berueh_-_(MeisterDrucke-1328884).jpg)
_-_De_dwerg_Hans_Sausakh_von_Wurstelfeld_ca_1710Hans_Sausakh_von_Wurstelfeld_Berueh_-_(MeisterDrucke-1328884).jpg)
_-_De_dwerg_Nicolas_Charon_als_een_generaal_van_de_cavalerie_ca_1710Nicolas_Charon_-_(MeisterDrucke-1327055).jpg)
_-_De_dwerg_Nicolas_Charon_als_een_generaal_van_de_cavalerie_ca_1710Nicolas_Charon_-_(MeisterDrucke-1327055).jpg)
_-_De_vrolijke_dwerg_Mathias_Flecksippl_ca_1710Mathias_Flecksippl_faisant_le_bel_hu_-_(MeisterDrucke-1327473).jpg)
_-_De_vrolijke_dwerg_Mathias_Flecksippl_ca_1710Mathias_Flecksippl_faisant_le_bel_hu_-_(MeisterDrucke-1327473).jpg)
_-_De_Franse_dwerg_Madame_Palatinelle_ca_1710Madame_Palatinelle_in_der_grossen_Gall_-_(MeisterDrucke-1328545).jpg)
_-_De_Franse_dwerg_Madame_Palatinelle_ca_1710Madame_Palatinelle_in_der_grossen_Gall_-_(MeisterDrucke-1328545).jpg)
_-_De_dwerg_Nicolo_Cantabella_ca_1710Nicolo_Cantabella_Savoijardischer_Wurmschneide_-_(MeisterDrucke-1328700).jpg)
_-_De_dwerg_Nicolo_Cantabella_ca_1710Nicolo_Cantabella_Savoijardischer_Wurmschneide_-_(MeisterDrucke-1328700).jpg)
_-_De_dwerg_Robert_von_Parukenfeldt_ca_1710Monsieur_Robert_von_Parukenfeldt_Ritter_-_(MeisterDrucke-1328781).jpg)
_-_De_dwerg_Robert_von_Parukenfeldt_ca_1710Monsieur_Robert_von_Parukenfeldt_Ritter_-_(MeisterDrucke-1328781).jpg)
_-_De_dwerg_Piters_Kahlmuess_Wisseller_als_walvisvaarder_ca_1710Den_Edlen_en_Vornae_-_(MeisterDrucke-1327676).jpg)
_-_De_dwerg_Piters_Kahlmuess_Wisseller_als_walvisvaarder_ca_1710Den_Edlen_en_Vornae_-_(MeisterDrucke-1327676).jpg)
_-_De_dwerg_Mademoiselle_Poupon_als_Parijse_schone_ca_1710Mademoiselle_Poupone_die_-_(MeisterDrucke-1327984).jpg)
_-_De_dwerg_Mademoiselle_Poupon_als_Parijse_schone_ca_1710Mademoiselle_Poupone_die_-_(MeisterDrucke-1327984).jpg)
_-_De_dwerg_Dan_Hagel_als_een_Hollandse_bootsknecht_ca_1710Dan_Hagel_Batavischer_Bo_-_(MeisterDrucke-1328019).jpg)
_-_De_dwerg_Dan_Hagel_als_een_Hollandse_bootsknecht_ca_1710Dan_Hagel_Batavischer_Bo_-_(MeisterDrucke-1328019).jpg)
_-_De_dwerg_Hanss_Guerge_Prijhann_als_woeste_officier_ca_1710Hanss_Guerge_Prijhann_-_(MeisterDrucke-1327683).jpg)
_-_De_dwerg_Hanss_Guerge_Prijhann_als_woeste_officier_ca_1710Hanss_Guerge_Prijhann_-_(MeisterDrucke-1327683).jpg)
_-_De_dwerg_Lucas_Hirnzwik_als_een_advocaat_ca_1710Dr_Lucas_Hirnzwik_beruehmter_Adv_-_(MeisterDrucke-1327214).jpg)
_-_De_dwerg_Lucas_Hirnzwik_als_een_advocaat_ca_1710Dr_Lucas_Hirnzwik_beruehmter_Adv_-_(MeisterDrucke-1327214).jpg)
_-_De_dwerg_Gustavus_Weinberger_als_een_geestelijke_met_een_beker_ca_1710Eximius_et_-_(MeisterDrucke-1327001).jpg)
_-_De_dwerg_Gustavus_Weinberger_als_een_geestelijke_met_een_beker_ca_1710Eximius_et_-_(MeisterDrucke-1327001).jpg)
_-_Karikatuur_van_Porzellana_KinkankPorzellana_Kinkank_Kuey_Chinkim_Chom_Eine_Mogol_-_(MeisterDrucke-1327923).jpg)
_-_Karikatuur_van_Porzellana_KinkankPorzellana_Kinkank_Kuey_Chinkim_Chom_Eine_Mogol_-_(MeisterDrucke-1327923).jpg)
_-_De_dwerg_Liendl_Schnekenfist_ca_1710Liendl_Schnekenfist_des_Wienerischen_Nacht-k_-_(MeisterDrucke-1327123).jpg)
_-_De_dwerg_Liendl_Schnekenfist_ca_1710Liendl_Schnekenfist_des_Wienerischen_Nacht-k_-_(MeisterDrucke-1327123).jpg)
_-_De_dwerg_Veith_Knollinger_von_Pinklfeldt_ca_1710Veith_Knollinger_von_Pinklfeldt_-_(MeisterDrucke-1328095).jpg)
_-_De_dwerg_Veith_Knollinger_von_Pinklfeldt_ca_1710Veith_Knollinger_von_Pinklfeldt_-_(MeisterDrucke-1328095).jpg)
_-_De_dwerg_Frau_Agatha_Zipperlingin_met_hondje_ca_1710Frau_Agatha_Zipperlingin_geb_-_(MeisterDrucke-1327387).jpg)
_-_De_dwerg_Frau_Agatha_Zipperlingin_met_hondje_ca_1710Frau_Agatha_Zipperlingin_geb_-_(MeisterDrucke-1327387).jpg)
_-_De_dwerg_Nicolo_Caccatrippa_als_harlekijn_ca_1710Nicolo_Caccatrippa_famosa_Canai_-_(MeisterDrucke-1327086).jpg)
_-_De_dwerg_Nicolo_Caccatrippa_als_harlekijn_ca_1710Nicolo_Caccatrippa_famosa_Canai_-_(MeisterDrucke-1327086).jpg)
_-_De_dwerg_Malper_Huellriglin_als_waardin_ca_1710Malper_Huellriglin_Wuerthin_und_Z_-_(MeisterDrucke-1327852).jpg)
_-_De_dwerg_Malper_Huellriglin_als_waardin_ca_1710Malper_Huellriglin_Wuerthin_und_Z_-_(MeisterDrucke-1327852).jpg)
_-_De_dwerg_Riepl_Gleichdron_ca_1710Riepl_Gleichdron_Approbierter_und_Privilegierte_-_(MeisterDrucke-1328099).jpg)
_-_De_dwerg_Riepl_Gleichdron_ca_1710Riepl_Gleichdron_Approbierter_und_Privilegierte_-_(MeisterDrucke-1328099).jpg)
_-_De_dwerg_Vincentz_Zipperling_in_een_bontjas_ca_1710Herr_Vincentz_Zipperling_aelt_-_(MeisterDrucke-1327426).jpg)
_-_De_dwerg_Vincentz_Zipperling_in_een_bontjas_ca_1710Herr_Vincentz_Zipperling_aelt_-_(MeisterDrucke-1327426).jpg)
_-_De_dwerg_Iupanschku_Ferenz_ca_1710Iupanschku_Ferenz_Richter_auss_der_Raubau_fueh_-_(MeisterDrucke-1327632).jpg)
_-_De_dwerg_Iupanschku_Ferenz_ca_1710Iupanschku_Ferenz_Richter_auss_der_Raubau_fueh_-_(MeisterDrucke-1327632).jpg)